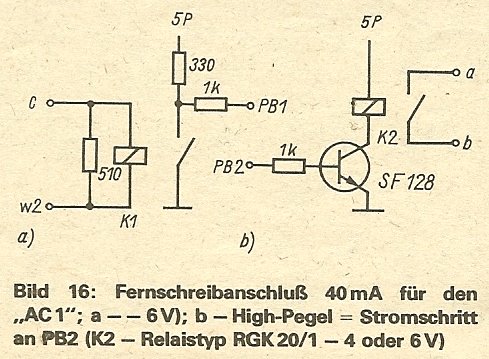
...
Funkamateur 05/84 |
...
Die Schaltung zum Anschluß eines Fernschreibers bzw. zu seinem
Ersatz durch "AC1" ist in Bild 16
dargestellt. Sie hat dem Rechner eingabeseitig zu signalisieren, ob
Linienstrom fließt oder nicht
und dementsprechend ausgabeseitig den Linienstrom zu schalten. Dieses
Interface realisiert also
nur die Funktion von Sendekontakt und Empfangsmagnet, es trennt den
Rechner galvanisch von der
Fernschreiblinie. Bei entsprechender Beschaltung des
Fernschreibsteckers ist es damit möglich,
die mechanische Maschine durch das elektronische Display zu ersetzen,
indem man nur die Stecker
austauscht. Die Linienstromquelle ist dann weiterhin erforderlich. Als
Relais werden 6V-Reed-Relais
verwendet, da mit Reed-Kontakten die erforderliche
Schaltgeschwindigkeit realisiert werden kann.
Bei gemeinsamem Betrieb dieser Interfaceschaltung und einer
mechanischen Maschine in einer Linie
mit relativ hoher Spannung der Linienstromquelle (über 60 V) kann
es zum Kleben des
Relaissendekontaktes infolge zu hoher Induktionsspannungsspitzen
kommen. Hier muß man entweder
ein größeres Reed-Relais einsetzen, oder man reduziert die
Spannung der Linienstromquelle auf
etwa 60 V. Diese Interfaceschaltung wurde bisher bei verschiedenen
Übertragungsraten, mit
mechanischer Fernschreibmaschine in Reihe, bis 50 Baud und als
Einzelgerät bis 110 Baud getestet.
Andere Schaltungen, die das gleiche logische Verhalten zeigen, sind
natürlich ebenfalls einsetzbar.
Hier ist z.B. in [8] eine weitere
Möglichkeit zum Anschluß eines Fernschreibers gezeigt.
Bei der Verbindung von Sender, Empfänger und RTTY-Display kann
auch ganz auf ein solches
Linienstrominterface verzichtet werden. Wichtig ist nur, daß am
Ende immer das gleiche logische
Verhalten für den PIO-Anschluß des Rechners realisiert wird.
Die Serien/ParallelWandlung,
das Kodieren und Dekodieren der Fernschreibzeichen erfolgt
vollständig per Software, wie es
später noch erläutert wird. In Verbindung mit dem
RTTY-Konverter ist dieses Interface auch für
den CW-Betrieb einsetzbar. Der Konverter wird dann im
Space-only-Betrieb als Tonfilter verwendet.
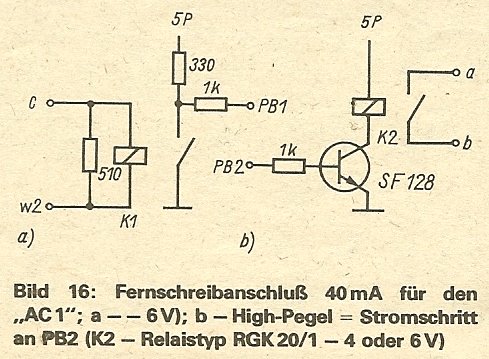
...
Diese beiden Programme sind nun schon spezielle Anwendungsbeispiele
für den Einsatz des "AC1" auf
dem Gebiet des Amateurfunks. Das CW-Programm wurde als
Morseschreibmaschine gestaltet. Nach der
Wahl der Geschwindigkeit erfolgt die exakte Ausgabe des eingegebenen
Textes, bis das zuletzt
eingegebene Zeichen erreicht ist. Zur Orientierung wird das jeweils
auszugebende Zeichen auf dem
Bildschirm durch einen Stern ersetzt, so daß man sofort sieht, an
welcher Stelle die Morseausgabe
gerade erfolgt. Eine Erweiterung zur Eingabe von Speichertexten und zur
Morsezeichendekodierung
ist vorgesehen.
Eine der interessantesten Anwendungen von Computern im Amateurfunk
dürfte wohl das Funkfernschreiben
sein. Deshalb wurde auch für den "AC1" ein RTTY-Programm
geschrieben und bereits mehrfach mit Erfolg
eingesetzt. Mit ihm ist es möglich, in jeder gebräuchlichen
Baudrate (ab 35 Bd in Schritten zu 1 Bd
aufwärts frei wählbar) RTTY-Funkbetrieb entsprechend dem
Telegraphenalphabet Nr.2 der CCITT
durchzuführen. Standardtexte wie RY-Schleife oder
Stationsbeschreibung lassen sich aus dem
Speicher abrufen. Durch den geschickten Einsatz von Speichertexten ist
es auch für Ungeübte
relativ schnell möglich, einen raschen RTTY-Funkbetrieb zu
realisieren. Das bei der mechanischen
Maschine notwendige Umschalten zwischen Buchstaben und Ziffern erfolgt
hier automatisch, mehr noch,
je Zeiteinheit, die 10 Fernschreibzeichen entspricht, wird das gerade
aktuelle Registerzeichen
automatisch in die Aussendung eingefügt. Damit erhöht sich
die Sicherheit der Übertragung.
Die Serien/Parallel-Wandlung und die Kodierung bzw. Dekodierung der
Fernschreibzeichen erfolgen
ausschließlich mit dem Grundmodul des "AC1" per Software. Im
Gegensatz zur mechanischen Maschine
tastet der "AC1" jeden Informationsschritt dreimal ab (bei 25, 50 und
75 % der Schrittweite)
und bildet daraus den Mittelwert. War z.B. kein echter Startschritt,
sondern nur ein Störimpuls
vorhanden, so bedeutet das den sofortigen Übergang zur
Empfangsbereitschaft. Wurde nicht
mindestens ein Stoppschritt erkannt, so erfolgt keine Ausgabe des
Zeichens auf dem Bildschirm.
Durch diese Maßnahmen ergibt sich gegenüber der mechanischen
Maschine eine größere Störsicherheit
und die Synchronisation beim Einschalten in eine laufende Sendung
erfolgt schneller.
Das Zeitraster zur Realisierung der entsprechenden Baudrate ist durch
den CTC vom quarzstabilisierten
Systemtakt des Rechners abgeleitet, so daß die Toleranz der
Baudrate im Bereich weniger Promille liegt
Ein weiterer, bestimmt nicht unerheblicher Vorteil eines solchen
RTTY-Displays ist seine vollständige
Geräuschlosigkeit, wenn man vom Tastengeräusch und dem
eventuellen Klappern eines Fernschreibrelais
einmal absieht. Eine Erweiterung auf den ASCII-Zeichensatz ist
möglich und vorgesehen.
...